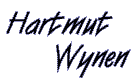Staiger Chrometron
Geschichte
Die Firma Gebr. Staiger GmbH wurde 1898 in St. Georgen im Schwarzwald als Hersteller von Isolationsmaterial für die Beleuchtungsindustrie gegründet. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde 90% des Maschinenparks als Reparationsleistung demontiert und die Kunststoffspritzgießtechnik war eine der übrig gebliebenen Produktionszweige. In diesem Zusammenhang wurden auch Gehäuse für Großuhren, im wesentlichen Wecker, gefertigt. Durch Zukauf von Werken wurde man nun zum Uhrenfabrikant und damit kam der Wunsch auf, auch eigene mechanische Werke zu entwickeln.
Zuerst wurden vor allem Reise- und Musikwecker gefertigt, später (ab 1967) dann unter dem Namen Chrometron elektromechanische und Quarzwerke. 1977 fertigte Staiger mit 450 Mitarbeitern ausschließlich Synchron- und Quarzuhrwerke. 1980 kam es zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens UTS (Uhrentechnik Schwarzwald) zusammen mit der auch in St. Georgen ansässigen Firma Kundo und Peter aus Rottweil (Anteil 10%). UTS hatte den Sitz in Hardt bei St. Georgen und produzierte Quarzwerke für Großuhren.
1992 fusionierten Kundo und Staiger zur Firma Kundo-Staiger Zeit und Technik. Der Bereich Wärmeverbrauchserfassung wurde von der Fusion ausgenommen und firmiert seit dieser Zeit unter dem Namen Kundo Systemtechnik. Im Jahr 2000 musste Kundo-Staiger dann Insolvenz anmelden. Die 1997 ausgegliederte UTS (jetzt U.T.S. Präzisionstechnik GmbH) gehört heute zur Obergfell Technology Group (OTG). 1996 hatte die UTS bereits die Produktion und den Verkauf von Quarzwerken für Großuhren von Junghans übernommen und ist heute (nach eigenen Angaben) weltgrößter Hersteller von Funkuhrwerken für Großuhren. (nach [Schmid2005])
Vorgeschichte
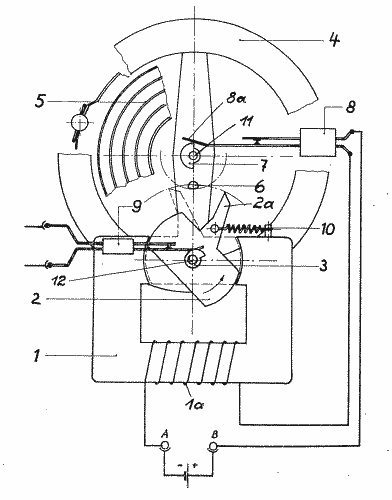
Mit der Einstellung von Reinhard Jäckle als Entwicklungsleiter 1955 beginnt die Geschichte der Chronometron Werke. Dieser hatte während seiner Studienzeit an der "Staatlichen Ingenieurschule für Feinwerktechnik" in Furtwangen ein elektromechanisches Chronometerwerk entwickelt und bei seiner Einstellung bei der Firma Staiger von dieser schützen lassen (Deutsches Gebrauchsmuster 1.749.993U vom 23. September 1955: "Elektromagnetischer Gangantrieb, insbesondere für Uhrwerke, Zeitschaltgeräte o. dgl.").
Bei diesem Werk schließt eine ansonsten frei schwingende Unruh (4) bei ihrem Nulldurchgang einen elektrischen Kontakt (8). Dieser schließt den Stromkreis für einen Elektromagneten (1) dessen Drehanker (2) dadurch in die Jochbleche des Elektromagneten gezogen wird und über einen am Anker angebrachten Mitnehmer (2a) einem Mitnehmerstift (6) und damit der Unruh einen Antriebsimpuls versetzt. Nachdem die Unruh durch den Nulldurchgang geschwungen ist, wird der Kontakt wieder geöffnet und der Drehanker durch die Rückstellfeder (10) wieder in seine Ausgangslage gebracht.
Der Antriebsimpuls ist weitgehend unabhängig von der Höhe der Spannung im Stromkreis. Außerdem leistet die Unruh keine Arbeit an ein Räderwerk zur Anzeige der Uhrzeit. Man kann daher mit einer gewissen Berechtigung von einer Chronometerhemmung sprechen.
Auswirkungen auf die Entwicklung elektrischer Uhren hatte dieses Patent zunächst nicht. Im Flume Werksucher G2 [Flume1967] von 1967 findet sich neben Synchronuhrwerken nur ein Batteriewerk (Kaliber 830) mit elektrischem Motoraufzug.
Elektromechanisches Chronometerwerk

Mitte der 60er Jahre wurde der Kostendruck immer höher, so dass ein neues Batteriewerk konstruiert werden musste, welches rationeller zu fertigen sein sollte. Aus der Firmengeschichte lag auch die Verwendung von Kunststoffteilen nahe. Bei dieser Gelegenheit entsann man sich des alten Chronometer-Patents und entwarf ein Batteriewerk, welches ohne den relativ teuren Gleichstrommotor auskam.
Ein erstes Patent dazu wurde am 30. Juni 1965 beantragt (Auslegeschrift 1.299.577). Die endgültige Konstruktion war mit Führungs- und Kontaktfeder am Schwinganker, die sich überkreuzen und so eine Gabel bilden in die ein Mitnehmerfinger auf der Unruh eingreift. Diese wurde als Zusatz zu diesem ersten Patent am 13. September 1965 eingereicht (Deutsches Patent 1.548.065). Reinhard Jäckle beschreibt das Chronometron-Prinzip so: "Eine freitragend gewickelte Spule, koaxial zu einem innenliegenden Permanentmagnet gelagert, wird bei Stromdurchgang vom radialhomogenen Magnetfeld in eine bestimmte Richtung gedreht. Das Drehmoment der Spule wird durch einen Hebel mit Schaltklinke auf das Sekundenrad übertragen. Gleichzeitig erhält der Gangregler (Unruh mit Spirale) über eine am Hebel angebrachte Blattfeder bei jeder zweiten Schwingung einen konstanten Antriebsimpuls. Der Gangregeler seinerseits betätigt dabei einen elektrischen Kontakt, wodurch die Spule kurzzeitig aktiviert wird."
Weitere Patentanmeldungen folgten
Patentanmeldungen wurden aber erst ein Jahr päter, am 13. Juli 1966 als Zusatz zu diesem Patent eingereicht (
Für dieses neue Werk wurde der Name "Chrometron" geschützt.
Erstes Quarzwerk

CQ 2000: 12. März 1971, 100 DM
Weitere Quarzwerke

CQ 2001: 17. März 1972, 45 DM
CQ 2002: 5. Juli 1973, 20 DM
CQ 2003: 1974
CQ 2004: 1977
(TOP)Die Chrometron-Werke
| Kaliber | Jahr | A/h | Batterie Verbrauch |
Abmessung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 1968 | 1 Hz | 1,5V; R14 | 67x80x36mm3 | Erster Chrometron Werk: Über Chronometer-Hemmung angetriebene Unruh Drehspulschrittschaltwerk, Spulenwiderstand 220Ohm |
|
| 875 | 1 Hz | 1,5V; R14 | 66x66x29mm3 | Verbessertes Chrometron Werk Drehspulschrittschaltwerk, Spulenwiderstand 170Ohm (gemessen) |
||
| CQ 2000 | 1971 | 16384 Hz | 1,5V; R14 1,4Ah/a |
80x71x28mm3 | erstes Quarzwerk: Schaltung mit 9 Transistoren und 2 bipolaren integrierten Schaltungen SAJ 170 (ITT/Intermetall, 7 stufiger Binärteiler) Drehspulwandler, Spulenwiderstand 300 Ohm |
|
| CQ 2001 | 1972 | 32768 Hz | 1,5V; R14 1,4Ah/a |
56x62x24mm3 | 2. Generation: Bipolare Integrierte Schaltung SAJ 220S (ITT/Intermetall, Quarzoszillator, 15 stufiger Binärteiler und Motorantriebsschaltung) Drehspulwandler, Spulenwiderstand 200 Ohm |
|
| CQ 2002 | 1973 | 4,19 MHz | 3V; 2*R14 1,4Ah/a |
90x56x24mm3 | 3. Generation: Integrierte CMOS Schaltung (Eurosil e1108, Quarzoszillator, 22 stufiger Binärteiler und Motorantriebsschaltung) Drehspulwandler, Spulenwiderstand 200 Ohm |
|
| CQ 2003 | 1974 | 4,19 MHz | 1,5V; R14 1,8Ah/a |
59x65x27mm3 | 4. Generation: Integrierte CMOS Schaltung (Eurosil e1114, Quarzoszillator, 22 stufiger Binärteiler und Motorantriebsschaltung) Drehspulwandler, Spulenwiderstand 400 Ohm |
|
| CQ 2004 | 1977 | 4,19 MHz | 1,5V; R14 2,0Ah/a |
? | 5. Generation: Stark verkleinerte Mechanik, Integrierte CMOS Schaltung (z.B. Eurosil e1150), Drehspulwandler | Spulenwiderstand 360 0hm |
| 1,5V; R6 1,6Ah/a |
? | Spulenwiderstand 450 0hm | ||||
| 1980 | 32768 Hz | 1,5V | ? | 6. Generation: Gemeinschaftsentwicklung von 5 deutschen Quarzuhr-Herstellern, gefördert
durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie Stimmgabelquarz, integrierte CMOS Schaltung und bipolarer Lavet-Schrittmotor. |
||
Patente
Liste der deutschen Patente und Gebrauchsmuster (sortiert nach Anmeldedatum)
| Veröffentlichungs- nummer | Anmelde- datum | Titel | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| DE 1.749.993U | 23.09.1955 | ELEKTROMAGNETISCHER GANGANTRIEB, INSBESONDERE FUER UHRWERKE, ZEITSCHALTGERAETE OD. DGL. | |
| DE 1.299.557A | 30.06.1965 | Elektromechanischer Gangantrieb fuer Uhren | |
| DE 1.548.065C | 13.09.1965 | Elektromechanischer Gangantrieb fuer Uhren | Zusatz zu 1.299.557 |
| DE 1.548.066C3 | 13.07.1966 | Elektromechanischer Antrieb für elektrische Uhren mit einer Drehspule | Zusatz zu 1.299.557 |
| DE 1.548.067A | 13.07.1966 | Elektromechanischer Antrieb fuer elektrische Uhren mit einer Drehspule | |
| DE 1.548.068A | 13.07.1966 | Anwerfvorrichtung fuer elektrische Uhrwerke | |
| DE 1.548.069C | 13.07.1966 | Elektromechanischer Gangantrieb fuer batteriebetriebene Uhren | Zusatz zu 1.299.557 |
| DE 6.927.650U | 10.07.1969 | BATTERIEBETRIEBENE UHR | |
| DE 7.146.975U | 14.12.1971 | Elektromechanischer Antrieb, insbesondere fur Uhren | |
| DE 2.403.289C3 | 24.01.1974 | Batteriebetriebene Weckeruhr | |
| DE 7.406.219U | 22.02.1974 | DREHSPULENANORDNUNG, INSBESONDERE ELEKTROMECHANISCHER WANDLER FUER EINE UHR | siehe 2.408.537 |
| DE 7.406.220U | 22.02.1974 | SCHRITTSCHALTWERK FUER EINEN ELEKTROMECHANISCHEN WANDLER EINER ELEKTRISCHEN UHR | siehe 2.408.538 |
| DE 2.408.537C3 | 22.02.1974 | DREHSPULENANORDNUNG, INSBESONDERE ELEKTROMECHANISCHER WANDLER FUER EINE UHR | siehe DGM 7.406.219 |
| DE 2.408.538C3 | 22.02.1974 | SCHRITTSCHALTWERK FUER EINEN ELEKTROMECHANISCHEN WANDLER EINER ELEKTRISCHEN UHR | siehe DGM 7.406.220 |
Literatur
- Staiger: Chrometron Quartz CQ 2001
Beschreibung und Service
St. Georgen: Eigenverlag, 1972 - Staiger Katalog 1975 (nur einzelne Seiten)
("Chrometron Batteriewerk Cal. 875", "Hochfrequenz Quarzuhrwerk CQ 2003") - Reinhard Jäckle: Zur Entwicklungsgeschichte der Quarz-Großuhr in St. Georgen im
Schwarzwald in den Jahren 1970-1990
in: Johannes Graf (Hrsg.): Die Quarzrevolution
75 Jahre Quarzuhr in Deutschland
Vorträge anlässlich der Tagung im Deutschen Uhrenmuseum Furtwangen am 20. und 21. August 2007
Furtwangen, Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen, 2008 [Graf2008] - ITT Intermetall: Integrierte Schaltungen für autonome Gebrauchsuhren
Freiburg, 1972 [Intermetall1972]
(CQ 2000, CQ 2001) - Franz Schmidlin: Elektrische + elektronische Batterie-Großuhren
Prinzip - Funktion - Reparatur
Lausanne: Bibliothek des Schweizer Uhren und Schmuck Journal, Scriptar S.A., 1972 [Schmidlin1972]
(Erstes Chrometron Werk Kaliber 852 und erstes Quarzwerk CQ 2000) - VDU: Elektro-Uhren-Mappe
Elektrische und elektronische Kleinuhren und Großuhren aus deutscher Produktion
VDU Verband der Deutschen Uhrenindustrie EV (Hrsg.) 1972 [VDU1972]
(CQ 2001) - Günther Glaser (Hrsg): Quarzuhrentechnik
Ulm: Wilhelm Kepter KG, 1979 [Glaser1979]
(S. 209f: Tabellarische Übersicht CQ2000-CQ2004, Schaltplan CQ2003)
auch als Artikelserie in NUZ Schmuck & Uhren o.O: NUZ Schmuck & Uhren, 15/1977, S. 28 - R. Jäckle: Kunststofftechnik und Uhrentechnik verwirklicht in einem neuen elektrischen Großuhrwerk
Staiger Chrometron 875
in: DGC Jahrbuch 1970 - Hans Vrolijk: Een batterijuurwerk met chronometergang
gefunden auf: ClockDoc - The Electric Clock Archive unter "Documents" - K.-E. Reinarz: Quarzoszillatoren für Quarz-Gebrauchsuhren und ihre Behandlung als negative Impedanzen oder Konduktanzen
(ITT) u.a. Quarzoszillator der Staiger Chrometron 2000
in: DGC Jahrbuch 1972 - H. Keller: Integrierte Schaltungen für Quarzuhren
ITT SAJ 220
in: DGC Jahrbuch 1972 - Staiger präsentiert das Mega-Hertz-Quarzwerk
in: Die Uhr (Uhren-Juwelen-Schmuck), Heft 15 (10. August) 1973 - Reinhard Jaeckle: Das Staiger-HF-Quarzwerk 4. Generation
Chrometron CQ2003
in: DGC Jahrbuch 1975 - Reinhard Jaeckle: Staiger HF-Quartzwerk 5. Generation
Chrometron CQ2004
in: DGC Jahrbuch 1976